Ach, was soll man zu dem Buch eigentlich sagen? So vieles und am Ende doch nichts, oder wenig, oder einfach nichts neues?
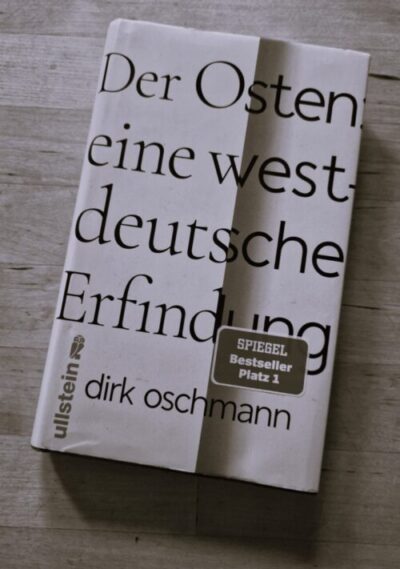
Wenn mir vor 30 Jahren eine Wette angeboten worden wäre, dass es heute solch ein Buch gibt, hätte ich dagegengehalten. Die harten ökonomischen Fakten des Unterschiedes, die Oschmann immer wieder anführt, bestimmten zwar auch damals schon das Leben für die meisten Menschen im Osten. Ich wäre allerdings davon ausgegangen, dass sich doch mehr „verwächst“ und die Differenz sich zunehmend mit anderen regionale Unterschieden überlagert und dadurch letztlich an Bedeutung verliert.
Doch es ist nun so, dass es dieses Buch gibt. Und der durch und durch westdeutsche Verlag auch noch das Glück hatte, noch im Erscheinungsjahr die 13. Auflage unters Volk hauen zu können. Wochenlang Platz 1 von Bestsellerlisten. Oschmann tourt durch die Gegend und ist ein gern gesehener Gast auf Veranstaltungen, vornehmlich im Osten, auch wenn der Verlag davon redet, es gäbe eine große bundesdeutsche Resonanz. Ein Kommentar aus dem Osten zu einer der Veranstaltungen auf einer Ticketplattform: „Danke Prof. Oschmann, dass war längst fällig!!!“
Was war denn nun fällig? Das erneute Aufzählen all der ökonomische und sozialen Ungerechtigkeiten? Eher nicht, die Sachen sind bekannt und anderweitig umfänglicher und detaillierter zugänglich. Wohl eher die Wut-Abrechnung, die hier einer vornimmt, einer, dessen Sprechposition ihn dazu in der öffentlichen Wahrnehmung zu legitimieren scheint. Gerade weil er nicht der klassische Ost-Verlierer ist, sondern sich im überaus harten und nach wie vor massiv westdeutsch dominierten Wissenschaftsbetrieb durchgesetzt hat, einer der wenigen „Ost-Professoren“. Wohl auch daher bewusst die Anrede oben, „Danke Prof. Oschmann“.
Bücher, auch populär geschriebene wie das vorliegende, zur Rolle des Ostens nach 1990 gab es schon einige. Fast eine Art frühzeitiges Gegenmodell dazu war Wolfgang Englers „Die Ostdeutschen als Avantgarde“, 2002 im einem Ost-Verlag erschienen. Engler wollte aus den Differenzen utopisches Potential schlagen, sah den Osten als Labor der Zukunft für das gesamte Deutschland. Nun, man könnte heute sagen, dass das Interesse daran eher überschaubar war, sieht man von den dann doch laborhaft erprobten neuen prekären Arbeitsverhältnissen ab. Also Utopie nach hinten als nach vorn.
Engler betrieb dabei schon das, was man auch Oschmann letztlich vorwerfen kann: Eine „Selbst-Ethnisierung“ des Ostens, die diskursive Schaffung einer Position, von der aus dann das eigene Sujet an Frau und Mann gebracht werden kann. Diese Ethnisierung ist aber nicht nur eine theoretische Denkfigur der Autoren, sondern findet sich auch landauf landab in den Selbstzuschreibungen im Osten: Man gehe nur in ein beliebiges Fußballstadion auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und höre zu, was gesungen wird oder lese, was auf den Blockfahnen steht. Oder wenn die erfolgreiche Abwehrarbeit eines Volleyballbundesligisten im Spiel gegen einen West-Verein mit dem vielstimmigen Chor „Ostblock – Ostblock“ belohnt wird.
Die Freude über den eigenen Ost-Verein mischt sich mit den von Oschmann so eindrücklich beschriebenen Negativ-Erfahrungen der Nachwendejahre, mischt sich mit ironisierenden Selbst-Zuschreibungen über den Osten an sich mit seinen arbeitsscheuen, gefräßigen aber trinkfesten Einwohnern. Irgendwo steckt da auch Stolz drin, auch wenn der Begriff sicher nicht ganz unproblematisch ist. (Eine nationalistische und stolz-getränkte Besetzung des Thema kann z.B. zuletzt verstärkt bei den diversen „Simson“-Treffen in Ostdeutschland beobachtet werden.)
Die positive Besetzung der benannten Punkte schafft eine regionale Verbundenheit, die über ähnliche Mechanismen in anderen Regionen Deutschlands oder Europas hinausgeht. Oschmann ist sich dieser kaum auflösbaren Ambivalenz sehr bewusst: Das Reklamieren einer falschen, da diskriminierenden „Schaffung“ des Ostens durch den Westen und gleichzeitig das Bestehen auf der eigenen Andersartigkeit.
Insofern führt der Buchtitel auch in die Irre, hatte aber sicher seine Effekte für die Steigerung der Auflage. Also auch nur Kapitalismus, Baby … Das dieser Verlierer hat, ist an sich schon beklagenswert. Wenn diese aber regional höchst ungleich verteilt sind, ja, was dann eigentlich? Ist die deutsche Einheit dann hergestellt, wenn ein Ostdeutscher zum Ministerpräsident eines westdeutschen Bundeslandes gewählt wird, wie mal jemand vor einiger Zeit nicht ganz unpassend formuliert hat? Das wird irgendwann allerdings kaum noch gehen, da die Zeit weg rennt, noch „echte Ossis“ aufzutreiben. Es sei denn, die Selbst- und Fremdethnisierung hält noch eine Weile an und wird auch auf die Kindeskinder übertragen. Im Moment ist das wohl nicht so abwegig …
„Dem Osten“ wäre selbst das aber eher egal, sah man doch schon zu DDR-Zeiten ein Ministerium lieber in der Ferne in Berlin als zu Hause in der eigenen Stadt. Der Ossi, der im Westen MP wird, wäre dann eben kein richtiger Ossi mehr, denn er hätte die Seite zu „denen da oben“ gewechselt („oben“ und „drüben“ ist dann ganz ähnlich.)
Denn die Erfahrungen der Wendezeit sind alle noch da, haben sich sedimentiert ins regionale Bewusstsein. Seien es Demonstrationen gegen Fabriksschließungen mit Transparenten wie „Treuhand – Kohls Mafia im Osten“ oder der lange Hungerstreik der Bergarbeiter 1993 in Bischofferode, wo ein funktionierender Betrieb vom Westkonkurrenten übernommen und geschlossen wurde. (Als ich vor einiger Zeit das Kali-Besucherbergwerk Tiefenort besuchte, wurde meine Gruppe von einem ehemaligen Mitarbeiter in Bischofferode geleitet. Fragen danach beantwortete er sinngemäß, dass er darüber nicht sprechen möchte.) Das das geschlossene Kali-Bergwerk den Namen Thomas Müntzers trug, ist eine am Ende nur nebensächliche Farce der Geschichte.
Vor vielen Jahren habe ich mir mal die Frage gestellt, warum eigentlich nach der Wende im Osten kein massiver und anhaltender Protest gegen die ökonomischen, sozialen und emotionalen Zumutungen, die mit der nachhaltigen Delegitimierung der eigenen Vergangenheit einhergingen, entstanden ist. („Dunkeldeutschland“, Bundespräsident Gauck, ein Ostdeutscher, der sich noch eine Widerstandslegende zusammengegauckt hatte.) Die Frage war insofern falsch, dass es diese Proteste ja gab, nur fanden sie letztlich keinen konkreten politischen Ausfluss.
Geschichte geht selbstverständlich weiter und ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn sich jemand wie Oschmann mal so weit und pointiert aus dem Fenster lehnt. Lesenswert wird es insbesondere an den Stellen, wo Oschmann präzise beschreibt, wie Sprechpositionen in Interessengefüge und zeitbezogen zwischen Ost und West geschaffen, benutzt und (de-)legitimiert werden.
Ich gäbe jetzt doch einiges zu wissen, wie in weiteren 30 Jahren darüber gesprochen und geschrieben wird – aber vor allem, ob es die Bundesrepublik geschafft hat, tatsächlich „Gleichheitschancengleichheit“ herzustellen. Die aktuellen Verlierer, bildungsstatistisch gesehen, sind die jungen Männer im nicht-urbanen Raum im Osten. Die dahinterliegenden Einzelbiographien sind bei weitem keine Erfindungen, sondern letztlich ganz real.